Am 04. April 2024 durfte ich als Gast in der Instagram-Sprechstunde der OGZ (Our Generation Z) über Klassismus sprechen. Die Fragen, die mir dort in diesem lockeren Gespräch gestellt wurden, nehme ich zum Anlass, um auch hier noch einmal ausführlicher über meine Erfahrungen mit dem Thema Klassismus zu sprechen.
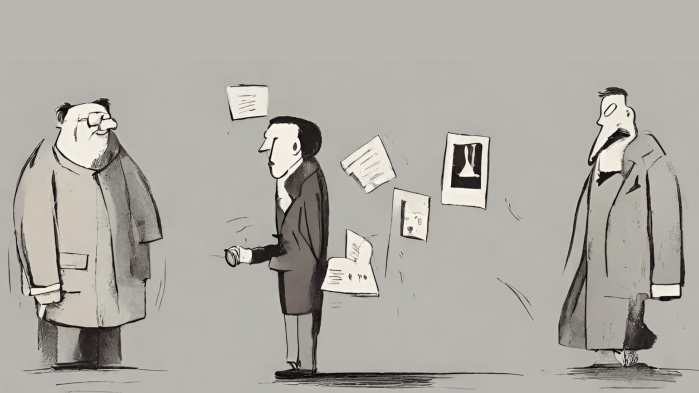
Kontext: Ich bin keine ausgewiesene Expertin auf diesem Gebiet, habe mich aber aufgrund meiner eigenen Erfahrungen und meiner Arbeit als Lehrerin für Erziehungswissenschaft und Psychologie damit auseinandergesetzt. Das Gespräch zielte auf meine persönlichen Erlebnisse ab und stellt demnach keine fachliche Abhandlung zum Thema dar. (siehe dafür exempl. die Arbeit von Francis Seeck oder Andreas Kemper: Hier ein DLF-Beitrag)
OGZ: Was ist Klassismus?
Der Begriff ›Klassismus‹ bezeichnet die Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer sozialen Herkunft oder ihres sozialen und ökonomischen Status, also zum Beispiel die Diskriminierung von Obdachlosen, Arbeitern oder armen Personen wie Bürgergeldempfänger*innen. (s. auch Wikipedia)
Dabei geht es aber nicht nur allein darum, wie viel Geld jemand hat oder mit wem man verwandt ist, es geht vor allem darum, dass ein bestimmtes Verhalten dieser Klasse zugeschrieben wird und das wird in erster Linie diskriminiert. Wenn ein Mensch in Armut aufgewachsen ist oder einmal obdachlos war und dann im Lotto gewinnt, hat er zwar mehr Geld, aber seine Art – man spricht hier in den Sozialwissenschaften von Habitus – ist noch dieselbe. An vielen Stellen handelt es sich dabei also um Fremdzuschreibungen, die auf stereortypen Vorstellungen oder Vorurteilen basieren (z.B. arme Leute sind nicht gebildet), und sich auf das gezeigte Verhalten und die äußere Erscheinung beziehen.
OGZ: Welche Bedeutung hat Klassismus in der heutigen Gesellschaft?
›Klassistische Diskriminierung‹ ist nur möglich, weil wir uns in der Gesellschaft aufgrund einer Klassenzugehörigkeit (oder anderer Merkmale) voneinander abgrenzen (Distinktion) oder uns darüber identifizieren. Dabei handelt es sich erst mal um normale Entwicklungsprozesse (z.B. bei der Identitätsentwicklung in der Adoleszenz). Diese sozialen Klassen geben uns nämlich auch Halt und Orientierung, denn wir haben vor allem gerne Menschen in unserem Umfeld, die uns ähneln und mit denen wir auf Augenhöhe umgehen können – so befreunden sich studierte Personen vielleicht eher mit anderen Akademikern, weil hier eine ähnliche Interessenlage oder in etwa gleiche Bildungsvoraussetzungen vorliegen. Das hat natürlich komplexere Gründe als reinen Klassismus (z.B. Vermeidung von kognitiven Dissonanzen), aber es ist auch nur ein Beispiel zur Veranschaulichung.
Eine Auswirkung auf unsere Gesellschaft ist meines Erachtens, dass sich soziale Gruppen bilden und sich in dieser Folge verschiedene Kulturen nicht durchmischen – also eine Art ›analoge Filterblase‹ entsteht. Es führt auch dazu, dass wir dazu neigen, jemanden mit wenig Bildung auch gleichzeitig für dumm zu halten, obwohl Bildung und Intelligenz nicht einmal das gleiche meinen (vgl. z.B. hier). Das hat unter anderem etwas mit unserer Sozialisation und sozialer Wahrnehmung zu tun (vgl. z.B. hier). Aus meiner Perspektive führt Klassismus also erst mal zur Aufrechterhaltung der Trennung von Menschengruppen.
Eine Folge daraus ist aber auch, dass dann Menschen, die aufgrund ihres Habitus, also ihres Aussehens, ihrer Sprache, ihres Verhaltens und Auftretens (unbewusst) diskriminiert werden. Man unterstellt ihnen dann z.B., dass sie nicht klug sind und einen Job, auf den sie sich beworben haben, gar nicht richtig machen können, weil ihnen so etwas wie das ›soziale Rüstzeug‹ fehlt. Klassismus grenzt also vor allem Menschen aus finanziell und sozial schwachen Familien und Umfeldern von einer Teilhabe an unserer Gesellschaft aus.
OGZ: Welchen Einfluss hat Klassismus auf die Chancengleichheit?
Der aktuelle IQB-Bildungstrend (2022) benennt die soziale Herkunft als einen der größten Faktoren für schlechtere Leistungen und damit Chancengleichheit. Es gibt bestimmte (mal ausgesprochene, mal unausgesprochene) Schranken im Bildungsbereich, die Klassismus begünstigen.
So ist zum Beispiel die Schulempfehlung in der vierten Klasse von den Leistungen abhängig. Diese Leistungen werden aber ja von Lehrkräften, also Menschen vergeben, die wiederum auch in klassistischen Denkmustern gefangen sein können. Darüber hinaus ist das Bildungssystem stark unterfinanziert und Lehrkräfte massiv überlastet. Da bleibt eigentlich auch keine Kapazität mehr, um sich jedem Kind intensiv zuzuwenden.
In meinem Fall war das auch so. Ich habe in der vierten Klasse eine Empfehlung für die Haupt- und Realschule erhalten, weil meine Noten nicht gut waren und ich wenig mitgearbeitet hatte. Das hatte aber private, familiäre Gründe und nichts mit meiner tatsächlichen Leistungs- und Lernbereitschaft oder Intelligenz zu tun.
Es gibt keine rechtliche Verpflichtung, solchen Empfehlungen auch zu folgen und auch der Schulwechsel ist meist möglich, aber geht mit vielen Hürden und Reibungsverlusten einher. Es gibt da ja keine notenabhängige Zulassungsbeschränkung wie an den Universitäten. Auch das war bei mir so: Nach zwei Jahren auf der Hauptschule mit Einserschnitt und völliger Unterforderung hat meine Mutter sich dafür eingesetzt, dass ich auf das Gymnasium wechsle. Das war zwar nicht so leicht, hat aber am Ende Dank des Einsatzes unseres Oberbürgermeisters doch noch geklappt und ich konnte als erste in meiner Familie Abitur machen. Eine Bedingung für den Schulwechsel war damals, dass ich die 6. Klasse auf dem Gymnasium wiederhole. Das war auch gut so. Ein Beispiel für solche Reibungsverluste ist, dass ich es nicht gewohnt war, im Englischunterricht Englisch zu sprechen, auch die vier Fälle der deutschen Grammatik habe ich dadurch nie in der Schule gelernt. An ersteres habe ich mich gewöhnt und konnte schon nach einem Jahr wieder gute Noten vorweisen, letzteres hab ich dann im Studium nachgearbeitet…
Ein ganz anderes Problem, über das meiner Meinung nach im Zusammenhang mit Klassismus zu wenig gesprochen wird, ist aber die habituelle Diskriminierung. Die zwischenmenschliche Ausgrenzung führt u.U. auch zu schlechteren Leistungen, vor allem aber dazu, dass Menschen sich unwohl, falsch und schuldig fühlen (vgl. auch meinen Beitrag zum Impostor-Syndrom). Das kann in Schule dann zur Folge haben, dass sich junge Menschen auch weniger am Unterricht beteiligen, weil sie Hänseleien oder sogar Mobbing fürchten. Damit werden sie also in ihrer Leistungsfähigkeit ausgebremst, wenn sie kein Umfeld haben, dass sie dazu ermutigt, weiterzumachen und sich davon nicht abhalten zu lassen.
OGZ: Hast du als Kind/Jugendliche einen Unterschied als Kind der Arbeiterklasse verspürt?
Laut Definition gehöre ich gar nicht mal ›richtig‹ zur ›Arbeiterklasse‹ im ursprünglichen Sinne. Meine Mutter war Büroangestellte und mein Vater war (nicht allzu erfolgreich) selbständig; auch habe ich keinen Migrationshintergrund. Das heißt aber nicht, dass ich deshalb nicht klassistisch diskrimiert wurde.
Ich kann daher über Unterschiede nur mutmaßen. Für mich war es ja ganz normal, dass meine Familie wenig Geld hatte und eher ›einfachen‹ Berufen nachgegangen ist. Zwar war allen klar, dass Schule wichtig ist, aber so richtig bildungsaffin war meine Familie nicht. Bei uns gab es zum Beispiel kaum Bücher, Vorlesezeiten, Bildungsfernsehen oder Nachrichten und die einzigen Zeitungen auf dem Tisch waren die BILD oder die Fernsehzeitschrift.
Damals wusste ich auch nicht, was Klassismus ist. Gemerkt habe ich also eher, dass ich aufgrund von wenig Geld an vielem nicht teilhaben konnte. Wenn sich andere Kinder für irgendetwas kostspieliges verabredet haben – zum Beispiel ein Kinobesuch, das Schwimmbad oder so etwas Abenteuerliches wie eine Shoppingtour – war ich davon natürlich automatisch ausgeschlossen. Ich wurde auch nicht gefragt, weil sie ja schon wussten, dass ich mir das nicht leisten kann. Für mich gab es auch keine Kindergeburtstage mit tollem Bastelprogramm oder so etwas – ich vermute, weil das viel zu teuer war.
Als Kind habe ich darüber nicht so sehr nachgedacht und war eher mit Spielen und Rausgehen beschäftigt, aber als Jugendliche habe ich mich dadurch schon ausgeschlossen gefühlt. Ich habe mich zum Teil auch selbst ausgeschlossen. Da ich kein Taschengeld hatte und wusste, dass es meist knapp ist (meine Mutter war alleinerziehend), habe ich oft auch nicht gefragt, ob ich Geld fürs Kino haben kann. Ich habe dann eben Freundschaften zu anderen geknüpft, die auch nicht so viel Geld hatten oder die sich dann auch auf andere, kostengünstigere Aktivitäten eingelassen haben. Also das, was ich schon sagte: Man sucht sich seinesgleichen.
Ganz besonders hart getroffen hat mich diese klassistische bzw. habituelle Diskriminierung aber erst am Ende meines Studiums bzw. während meiner Promotion. Ich habe Germanistik und Erziehungswissenschaft studiert und hatte so viel Spaß an Literatur, dass ich gerne Literaturwissenschaftlerin werden/bleiben wollte. An den Unis findet man aber eher Kinder von Eltern, die auch schon studiert oder sich das irgendwie anders leisten können (vgl. z.B. den Hochschulbildungsreport). Im Ruhrgebiet, wo ich studiert habe, ist die Lage etwas entspannter, da es dort eine lange Tradition von Arbeitern gibt, aber auch da sind ›wir‹ in der Unterzahl.
Wenn man dann mal völlig unbedarft zu ersten Vorträgen oder Vorstellungsgesprächen an der Uni fährt und es einen komischen Blick nach dem nächsten hagelt, merkt man erst (im Nachhinein), was habituelle Diskriminierung wirklich bedeutet.
Zum Beispiel hatte ich mal an der Uni Bremen ein Vorstellungsgespräch für eine Stelle nach meinem Doktor. Dort sollte ich vorstellen, an welchem Projekt ich als nächstes Arbeiten wollte. Die Stellenkommission bestand aus mehreren wissenschaftlichen Angestellten und Professoren, die mich dazu befragt haben. Wenn ich auf etwas nicht antworten konnte, weil ich mich dazu erst einlesen musste, habe ich das so gesagt. In meiner Welt ist das völlig normal, sagen zu dürfen, wenn man etwas nicht weiß oder kann. Dort war es wohl einer der Gründe, weshalb ich die Stelle dann nicht bekommen habe. Einer der Professoren, der sehr freundlich und zugewandt war, rief mich danach sogar persönlich noch einmal an, um mir Mut zu machen, den akademischen Karriereweg nicht aufzugeben.
Das ist mir mehrere Male passiert. Erst später habe ich von anderen gehört, wie seltsam und ungewöhnlich das wohl ist, dass all diese Professor*innen sich dann noch mal persönlich melden, um mir Mut zu machen. Ich hab mich hinterher oft gefragt, ob das als eine Art Ritterschlag zu verstehen ist, der mir noch mal eine besonders gute fachliche Qualifikation bescheinigt. Lange fühlte sich das natürlich gut an und hat mich weiter angetrieben. Gebracht hat es mir aber nie etwas (vgl. dazu auch meinen Beitrag hier).
OGZ: Warum ist es so schwierig, seinem sozialen Status zu entfliehen?
Ich weiß nicht, ob man hier so pauschal antworten kann. Aus meiner Perspektive ist das ein doppeltes Problem: Auf der einen Seite liegt es an einem selbst, auf der anderen am System.
Ich meine damit: Mein sozialer Status ist ja erst einmal gegeben. Normalerweise sucht man sich nicht aus, in welche Familie man geboren wird oder welche Schicksalsschläge zu Obdachlosigkeit, Arbeitslosigkeit etc. führen. Um dem aber irgendwie ›entfliehen‹ zu können, muss ich das a) erst einmal wollen und dafür b) auch noch feststellen, wie das geht und c) dass ich dabei vielleicht auch Hilfe brauche, von der ich d) auch noch wissen muss, wo ich sie bekomme. Hilfe kann ein*e Mentor*in sein, finanzielle Stipendien oder schlichtweg wichtige Informationen über Hilfsangebote oder Strukturen (z.B. der ganze Behördenapparat). Jetzt könnte man sagen: Gibt es doch alles, findet man im Internet. Aber der Clou an der Sache ist ja wie bei jedem Problem der gleiche: Ich muss doch erst mal wissen, dass ich etwas nicht weiß, damit ich überhaupt merke, dass man das verändern kann und sollte. Wenn ich das begriffen habe, kann ich mich auf die Suche machen. Dafür muss ich dann wiederum genau wissen, wonach ich zu suchen habe.
Hier war für mich ein großes Problem. Ich mache noch ein Beispiel zur Veranschaulichung: Ein Professor hat mir immer zu Hausarbeiten, die ich geschrieben habe, zurückgemeldet, dass es mir an treffsicherem Fachvokabular fehlt und man das alles noch präziser benennen kann. Das war eigentlich eine wirklich gute Rückmeldung, die mir ein Problem aufgezeigt hat, mein Problem war aber eher dieses: Ich wusste, was ich meinte, aber nicht, wie es heißt. Wie soll ich jetzt diesen Begriff herausfinden? Es gibt Wörterbücher ja nur umgekehrt: Da schlage ich einen Begriff nach und erfahre, was er meint. Und selbst wenn es ein solches Wörterbuch gäbe, wüsste ich das ja nicht, wenn man mir das nicht sagt. Information erwächst ja nicht aus sich selbst heraus. Geholfen hätte mir also eher, dass mir gesagt wird, was die entsprechende Bezeichnung ist, die ich hätte nutzen können und sollen. Aber auch das scheint unausgesprochen verpönt gewesen zu sein (oder es kommt niemand auf die Idee, dass das ein Problem darstellt).
Das andere ist aber auch, dass Klassismus auf der Beurteilung des Habitus einer Person basiert. An ihm wird festgemacht, ob jemand zu einer Klasse gehört oder nicht. Wenn man also nun innerhalb seiner ›Klasse‹ – z.B. Arme – sozialisiert ist, gehört dieser Habitus zu einem, in andere Verhaltensnormen hat man keine Einblicke. Den Habitus der anderen Klasse – z.B. der Akademiker – kennt man also nicht automatisch, nur weil man an einer Uni ist, und müsste ihn erst mal lernen. Wie verhalte ich mich und wie spreche ich so, als käme ich aus einem Bildungshaushalt? Für mich war das echt ein Problem, ich wollte ja schließlich überhaupt nicht so tun, als wäre ich jemand anderes. Ich wollte mich einfach nur qualifizieren.
Das andere Problem ist nämlich das System: Selbst, wenn ich die Hürde genommen habe, zu wissen, dass ich Informationen oder Hilfe brauche, heißt das nicht, dass man sie auch kriegt. Wir nehmen aber mal an, dass man sie irgendwie doch gekriegt hat. Ist dann alles gut? Nein, denn vieles in der Gesellschaft läuft über gute Beziehungen unter der Hand. Da sind Stellen ausgeschrieben, auf die man eigentlich schon eine*n Wunschkandidat*in im Kopf hat oder da werden Gehälter und Boni ausgezahlt, weil man zusammen im Fußballverein ist oder so etwas. Da sitzen dann Professor*innen in Gremien, die sich weigern, Studierende besser zu unterstützen, weil sie ernsthaft finden, dass Uni völlig zurecht auf einem Selektionsprinzip beruht, damit dann die ›Elite‹ den Abschluss schafft (Stichwort: Distinktionsgewinn). Diese Beziehungen in ›höhere Kreise‹ oder Menschen in Entscheidungspositionen hat man ja aber normalerweise nicht, wenn man aus einer der schwächeren sozialen Klassen kommt.
Auch dazu kann ich wieder ein Beispiel aus einem Vorstellungsgespräch bringen. Genauer gesagt, ist es danach passiert. Ich hatte mich in Frankfurt auf eine Stelle beworben und wieder eine Absage erhalten. Auch hier bot man mir wieder an, mich persönlich anzurufen und mir die Gründe zu nennen (Ritterschlag?). Als Grund für meine Absage wurde mir gesagt, dass ich ja noch keine Erfahrung auf einer Stelle an einer Uni bzw. in akademischer Selbstverwaltung gesammelt hatte und man sich deshalb für eine andere Kandidatin entschieden habe. Diesen Grund habe ich immer wieder gehört und fing damals schon an, mich zu fragen, was an Selbstverwaltung so eine Raketenwissenschaft ist, dass mir niemand zutraut, mich da kurz einzuarbeiten. Da die Professorin sehr freundlich und aufgeschlossen war, habe ich mich dann getraut anzumerken, dass ich folgendes Problem feststelle: Wenn ich mich auf eine Stelle an der Uni bewerbe und man nimmt mich nicht, weil ich noch keine Stelle an der Uni hatte (z.B. eine Promotionsstelle), beißt sich die Katze ja auch irgendwie in den Schwanz – irgendeiner müsste ja mal der bzw. die erste sein, der/die einem eine solche Stelle gibt. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber in dem Moment hatte ein wenig den Eindruck, dass das das erste Mal war, dass das jemand so gesagt hat.
Das System ist also total paradox, kreist enorm um sich selbst und zieht selbst bei Bestleistungen, jeder Ambition der Welt und vielen genommenen Hürden immer noch eine künstliche Glasdecke ein, durch die man nicht weiter aufsteigen kann. Denn am Ende umgibt sich jeder Mensch eben doch am liebsten mit anderen, die so sind wie man selbst…
OGZ: Was könnte man gegen Klassismus tun?
Wenn ich dafür eine gute Lösung hätte, würde ich vielleicht in die Politik gehen. Um ehrlich zu sein: Ich weiß es nicht. Ähnlich wie bei Rassissmus und Sexismus müsste hier gesamtgesellschaftlich ein starker mentaler Umschwung passieren.
Es gibt allerdings sehr viele Stiftungen und Vereine, die versuchen, aktiv dagegen anzukämpfen. Zum Beispiel der Verein Chancenwerk, der in sozialen Brennpunkten kostenlose Nachhilfe ermöglicht. Auch die START-Stiftung organisiert finanzielle Unterstützung für Jugendliche aus sozial schwachen Familien und auch der Verein Arbeiterkind fördert – wie der Name sagt – Arbeiterkinder, die als erste in ihrer Familie ein Studium aufnehmen. Inzwischen haben einige Unis, z.B. die Uni Bochum, eigene TalentScouts, die durch die Schulen ziehen. Ich glaube aber, dass diese Maßnahmen nicht reichen (vgl. hier). Zum einen sind das viel zu wenig Mittel, um allen helfen zu können. Zum anderen berühren sie das Problem, das ich heute versucht habe nahezubringen: Wie kommen denn die, die diese Hilfe brauchen, an die Leute, die wissen, wie es geht, wenn die Organisationen überwiegend nur zu Bewerbung aufrufen? Schülerstipendien z.B. fördern fast nur Berufsschüler mit guten Noten oder Abiturienten. Was ist aber mit allen anderen? Die müssten nicht nur wissen, dass diese Angebote existieren, sondern erst mal auf die Idee kommen, nach so etwas zu recherchieren.
Ich habe einige Hoffnung in Quoten oder anonymisierte Bewerbungen gesetzt. Ich denke aber auch, dass das nur ein Symptom an der Oberfläche kurieren würde. Während ich durch anonyme Bewerbungen vielleicht meine Chancen, zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden, verbessere, weil mein Geschlecht, mein Name oder meine Herkunft mir sonst etwas verbauen, hilft mir das ja erst am Ende meiner Qualifikationsphase. Ich denke aber, dass meine geschilderten Erfahrungen deutlich aufzeigen, dass das Problem ja schon vorher in Schule, Ausbildung oder Uni bestehen. Chancengleiheit darf man ja nicht mit genereller Gleichheit verwechseln. Wenn jemand bei einem Sprint als erste*r ins Ziel kommt, weil er/sie gut trainiert ist, würde es ja auch nicht helfen, wenn man mir kurz vor dem Ende Elektrolyte verabreicht. Was ich bräuchte, wäre ein gutes Training, in dem ich lerne, aus eigener Kraft Chancen auf den Sieg zu haben und entsprechende Ressourcen zu nutzen und klug einzusetzen. Bei diesem Training wiederum denke ich, könnte man mit Maßnahmen ansetzen, die Gräben überwinden helfen (z.B. Schule als Lernraum oder Zufluchtsort, Mentoring, Nachhilfe, Ausstattung, finanzielle oder ideelle Förderung u.ä.).
Ich fürchte aber, dass die Mentalität unserer Gesellschaft die weitaus größere Hürde ist, denn sie verhindert ja auch, dass Fördermaßnahmen erfolgen. Vieles ist durch Machtstrukturen bedingt, die erhalten werden sollen (z.B. in solchen Aussagen erkennbar: »Irgendwer muss doch aber hier auch den Müll leeren« oder »Wir können eben nicht alle Anwälte werden« – irgendwer sind alle, man selbst ist natürlich die erfolgreiche Ausnahme). Das liegt vielleicht daran, wie Menschen nun mal denken. Es ist normal, Dinge, die sich ähnlich sind, in eine Kategorie zu bündeln. Man stelle sich mal vor, wie aufwändig und kräftezehrend das Leben wäre, wenn wir Situationen nicht mit bereits vorhandenem Wissen abgleichen könnten… Gleichzeitig sind diese Stereotypen ein großes Problem. Das einzige Gegenmittel, das mir bekannt ist, ist, sich das bewusst zu machen und es zu reflektieren, um dann bewusst einen anderen Umgang mit seinen Mitmenschen zu suchen. Also ganz ohne Shaming – weder für Menschen aus sozial schwachen Klassen noch für diejenigen, die irgendwie auch nichts für ihre anerzogenen Vorurteile können. Sie können sie ja nicht einfach auslöschen, aber man kann lernen, anders damit umzugehen.
Literaturempfehlungen
Nachfolgend gebe ich gerne ein paar Literaturempfehlungen (chronologisch) für diejenigen, die das Thema gerne weiterverfolgen möchten:
- Kemper/Weinbach: Klassismus. Eine Einführung. Münster: UNRAST Verlag 22016.
- Reuter/Gamper/Möller/Blome (Hgg.): Vom Arbeiterkind zur Professur. Sozialer Aufstieg in der Wissenschaft. Bielefeld: transcript 2020.
- Seeck/Theißl: Solidarisch gegen Klassmismus. Organisieren, intervenieren, umverteilen. Münster: UNRAST Verlag 22020.
- Bahr/Eichhorn/Kubon (Hgg.): #95vsWissZeitVG. Prekäre Arbeit in der deutschen Wissenschaft. Marburg: Büchner-Verlag 2021.
- Barankow/Baron: Klasse und Kampf. Berlin: Ullstein 2021.
- Bahr/Eichhorn/Kubon: #IchBinHanna. Prekäre Wissenschaft in Deutschland. Berlin: Suhrkamp 2022.
- Seeck: Klassismus überwinden. Wege in eine sozial gerechte Gesellschaft. Münster: UNRAST Verlag 2024.
